
|
Titel | |||

|
Grußworte
|
|||

|
Vorwort
|
|||

|
Abstracts und Personalien der Referenten |
|||

|
Beiträge | |||

|
Zur Abschluss- diskussion |
|
von
Prof. Dr. B. Zimmermann
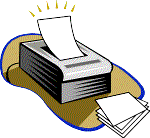 |
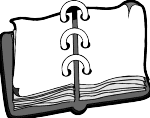 pdf-Datei |
Für diese Tagung gab es zwei Ziele:
- Einerseits sollte es um interessante konkrete Beispiele wissenschaftlicher Entdeckungen und wissenschaftlichen Entdeckens gehen, die einem interessierten Publikum vorgestellt werden können.
- Andererseits sollten aber auch Überlegungen über allgemeine Prinzipien der Entstehung von Innovationen in der Natur oder im menschlichen Geist thematisiert werden.
Warum eine solche Tagung?
"Kreativität und Innovationen" - wer redet heute nicht davon? Das ist sicher auch ein Modethema! Für uns konnte das aber kein Grund sein, eine solche Tagung nicht zu veranstalten.
Die Anregung für diese Veranstaltung geht vor allem zurück auf jahrelange und "prae-modische" Erfahrungen mit dem "Hamburger Modell zur Identifizierung und Förderung mathematisch besonders befähigter Schüler", das insbesondere inhaltlich ganz wesentlich durch Herrn Professor Karl Kießwetter gestaltet wurde und wird und dem ich dafür auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken möchte. Das "Markenzeichen" dieses sehr erfolgreich nun schon fast 20 Jahre laufenden Projektes ist gegenüber anderen wichtigen Talentförderprojekten gerade in besonderer Weise und in besonderem Umfang die Förderung von Kreativität beim Betreiben von Mathematik. Im vergangenen Jahr hatten wir, Herr Kießwetter und ich, aufgrund einer Einladung des seinerzeitigen IMUK-Präsidenten Herrn Professor Miguel de Guzman die Gelegenheit, dieses Modell in Madrid vorzustellen und bei der Implementierung hieran orientierter Fördermaßnahmen dort (und für andere Orte in Spanien) behilflich zu sein. Auch ein solches schon mehrfach erfahrenes "feedback" auf internationaler Ebene ermutigt uns, Anregungen aus diesem Projekt in vielfältiger Weise weiterzutragen.
Soviel zum biographischen Hintergrund unseres Jenaer Symposiums.
Gründe für die Ausrichtung der Tagung von weitreichender Bedeutung bieten sich insbesondere in den Bereichen Wirtschaft/Industrie, Wissenschaft und Ausbildung wie selbstverständlich an. Dabei gibt es natürlich Zusammenhänge zwischen diesen Bereichen, wobei einer von zunehmender Wichtigkeit durch das Stichwort "Globalisierung" angedeutet sei.
- Wirtschaft und Industrie:
- Wissenschaft:
- Bildung und Ausbildung:
Es ist wohl Konsens, daß Innovationen und kreatives Denken für viele Bereiche von Wirtschaft und Industrie von großer Bedeutung sind. Die Forderung nach Konkurrenzfähigkeit stellt sich gerade im Zeitalter zunehmender globaler Verflechtungen dringlicher denn je. Hier sind Generierung von Ideen hoher Qualität sowie deren zügige praktische Umsetzung sehr wichtig.
Für diesen Bereich sind nach m. E. "Innovationen und kreatives Denken" auf mindestens zwei Ebenen von fundamentaler Bedeutung:
Zum Einen brauchen alle wissenschaftlichen Disziplinen diese Faktoren als wesentliches "Lebenselexier", sie konstituieren ihren Fortschritt. Auch deswegen ist die Präsentation gelungener Beispiele über Entdeckungen von großem Interesse. In diesem Zusammenhang soll angemerkt werden, daß eine generelle Unterscheidung von "Forschung" (als "eigentliche" Wissenschaft) und "Entwicklung" unpassend scheint. Denn die Geschichte der Wissenschaften ist voll von Beispielen inniger Verknüpfung beider Bereiche. So werden z. B. mathematische Probleme, Sätze und Theorien entdeckt, entwickelt, erfunden oder erforscht. Ähnliches gilt auf der Metaebene des Betreibens von Wissenschaft: Wenn auch die analytische Wissenschaftstheorie oftmals eher einer "Pathologie" der Wissenschaft(sdynamik) gleicht, die den Fortschritt der Wissenschaften nicht einmal immer "sauber" rekonstruieren kann (geschweige denn ihn mit konstruieren helfen kann), so beschreiben und befördern doch Untersuchungen wie die von T. S. Kuhn und I. Lakatos in gewisser Weise das reale Leben von Wissenschaftlern und das Betreiben von Wissenschaft.
Damit bin ich schon bei der zweiten Ebene, auf der "Innovationen und kreatives Denken" von Interesse für die Wissenschaften sind. Diese beinhaltet die Methodologie von Entdeckungen und Erfindungen als eigenen Forschungs- und Entwicklungs(!)gegenstand der Wissenschaften. Das bekannteste geschichtliche Beispiel dürfte das umfassende (Entwicklungs-!)Programm von Leibniz einer "characteristica universalis" als Sprache für eine allgemeine "ars inveniendi et dejudicandi" sein. Aus diesem Bestreben entstand nach Leibniz eigenen Worten u. a. sein Differential- und Integralkalkül.
Beim Erforschen und Verstehen kreativer Prozesse wurde im vergangenen Jahrhundert vor allem von Psychologen sehr verdienstvolle Arbeit geleistet. Diese Arbeiten werden durch interessante Beiträge ausgewiesener Kollegen in diesem Bereich in dem vorliegenden Band ergänzt.
Die computergestützte Vernetzung der Kommunikation in der Wissenschaft (genauer: in der Elementarteilchenphysik und hier besonders am CERN) war wesentliche Keimzelle dessen, was wir heute als Internet kennen, das einen zentralen Beitrag zur Globalisierung leistet.
In jüngster Vergangenheit hat die große internationale Untersuchung zum mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht TIMSS viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erhalten. Ihre Ergebnisse sind für Deutschland nicht gerade schmeichelhaft. Mögliche Ursachen hierfür sind vielfältig. Die Untersuchung selbst, ihre Methoden und die bei ihr verwendeten Aufgabenpools sind z. T. durchaus diskussionswürdig. Auf jeden Fall aber gab und gibt sie Anlaß, über Qualität und Standards der Ausbildung in Deutschland insbesondere in den untersuchten Bereichen neu nachzudenken.
Ein Nebenziel unserer Tagung kann daher auch darin gesehen werden, Standards von erfolgreichen Experten im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich setzen oder zumindest markieren zu lassen, die auch Orientierungshilfen für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht geben können.
Ein weiterer sehr wesentlicher pädagogischer Grund für die Beschäftigung mit unserer Thematik ergibt sich aus der Tatsache, daß gerade junge Schüler ein hohes Kreativitäts- und Innovationspotential haben, das leider oftmals im Laufe der Schulzeit abhanden zu kommen scheint. Ein wichtiges Anliegen muß daher sein, dieses Potential zu pflegen und zu fördern. Dieses sollte nicht nur aus Gründen der Verbesserung wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit geschehen, sondern auch aus Respekt vor dem individuellen Bedürfnis zum kreativen und innovativen Handeln und Agieren insbesondere bei Kindern. U. a. aus diesem Grund müssen mehr Frei- und "Spiel-Räume" geschaffen werden. Dieses gilt für Kinder, Jugendliche und Lehrer gleichermaßen. Hiermit stellt sich auch eine Herausforderung an die Aus- und Weiterbildung von Lehrern, denn deren Kreativität gilt es natürlich auch zu fördern, damit sie dann die Kreativität von Schülern unterstützen können (s. auch die Abschlußdiskussion).
Warum eine interdisziplinäre Tagung?
Für einen Didaktiker ist es naheliegend, fächerübergreifendes Arbeiten als wünschbare Lernform auch bei der Planung eines Symposiums zu berücksichtigen. Die Möglichkeit zum Lernen von jeweils anderen, weniger vertrauten aber doch noch hinreichend verwandten Disziplinen war ein wesentlicher Grund, die Tagung in dieser Form und Zusammensetzung zu veranstalten. So waren auch synergetische Effekte zu erhoffen.
Warum in Jena?
Jena ist ein Ort mit großer Tradition. Diese wird ganz wesentlich durch die Universität und durch die hiesige Industrie sowie deren schon lange übliche Zusammenarbeit konstituiert und getragen. Auch daher konnte ich mir kaum einen besser geeigneten Ort für eine Tagung über diese Thematik vorstellen!
Zu den Beiträgen dieses Symposiums.
Auf dieser Tagung trugen Vertreter von insgesamt sieben verschiedenen Wissenschaften vor:
Informatik (Prof. Dr. H. Stoyan sowie Dr. M. Müller von der Universität Erlangen-Nürnberg); Ingenieurwissenschaften (Prof. Dr. G. Höhne und Dr. H. Sperlich von der TU Ilmenau sowie Prof. Dr. Spies von der RWTH Aachen), Mathematik (Prof. Dr. I. Althöfer von der FSU Jena und Prof. Dr. A. Dress von der Universität Bielefeld), Mathematikdidaktik (Frau Prof. Dr. L. Hefendehl-Hebeker von der Universität Augsburg, Dr. F. Heinrich von der FSU Jena, Prof. Dr. K. Kießwetter von der Universität Hamburg, Prof. Dr. Th. Weth von der Universität Erlangen-Nürnberg, Prof. Dr. H. Winter von der RWTH Aachen, Prof. Dr. B. Zimmermann von der FSU Jena), Philosophie (Prof. Dr. G. Gabriel von der FSU Jena), Physik (Prof. Dr. G. Schäfer von der FSU Jena) sowie Psychologie (Prof. Dr. D. Dörner von der Universität Bamberg sowie Prof. Dr. W. Krause, Dr. R. Goertz, Dr. F. Heinrich, Dr. J. Ptucha, Frau PD. Dr. B. Schack, Frau Dipl. Psych. G. Seidel von der FSU Jena, Dr. W. Gundlach von der Universität Potsdam und Frau Doz. Dr. E. Sommerfeld von der Universität Leipzig).
Es war auch ein Vortrag des bekannten Kognitionspsychologen Prof. Dr. F. Klix vorgesehen, der aber leider krankheitshalber ausfallen mußte.
Die Beitragsredaktion war sehr darum bemüht, die Randbedingungen bezüglich Zeit, Formatierung und Umfang ausgleichend zu berücksichtigen. Dieses ist leider nicht immer gelungen. Wir bitten alle Betroffenen um Nachsicht!
Der Bericht über die Tagung wird ergänzt durch Wiedergabe wesentlicher Passagen der Podiumsdiskussion, in der sich u. a. "spielerisches Betreiben von Mathematik" und "Verkaufen von Mathematik" als zwei wichtige Leitideen herausschälten.
Organisiert durch meinen Kollegen Professor Ingo Althöfer fand als würdige "Einrahmung" dieser Veranstaltung ein Schachspiel zwischen den beiden Großmeistern Jussupow und Lutz statt, die sich hierbei die "Dreihirntheorie" von Herrn Althöfer zu Nutze machten. Hierüber wird in einem gesonderten Beitrag von Herrn Althöfer berichtet.
Alle Beiträge für diesen Tagungsband wurden direkt als Typoscript übernommen.
Den Abschluß bilden Kurzbiographien der Referenten und eine Liste von Tagungsteilnehmern.
Sie zeigt u. a., daß die Tagung auch auf internationaler Ebene Beachtung fand.
Unser Dank gilt insbesondere allen Referentinnen und Referenten, die durch ihre Beiträge wie auch in anregenden Diskussionen ganz wesentlich zum Gelingen der Tagung beigetragen haben. Hier ist insbesondere auch die sehr entspannte und anregende Atmosphäre zu nennen, die bekanntlich eine sehr wichtige Voraussetzung für die Entstehung kreativer Prozesse ist.
Nicht weniger herzlich möchten wir dem Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena Herrn Prof. Dr. G. Machnik danken, der wohlwollend und engagiert dieses Unternehmen unterstützt hat, wie auch seine hier abgedruckte Grußadresse noch einmal belegt.
Die Organisation der Tagung wie auch die Redaktion dieses Bandes wurde durch Mitglieder der Abteilung für Didaktik der Mathematik und Informatik durchgeführt, d. h. durch die Damen K. Bräuning, E. Janeck, N. Serfling sowie die Herren PD. Dr. G. David, T. Fritzlar, Dr. F. Heinrich, PD. Dr. M. Schmitz. Für die von diesen Personen geleisteten z. T. sehr umfangreichen Arbeiten möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken.
Mein Dank gilt auch meinem Kollegen Herrn Prof. Dr. I. Althöfer sowie den beiden Schachgroßmeistern Jussupow und Lutz für die Durchführung eines sehr spannenden und instruktiven Schachturniers.
Herrn Prof. Dr. A. Dress möchte ich nochmals für seine mit großer Sorgfalt und Geduld durchgeführte Korrekturhilfe bei der Redaktion der Abschlußdiskussion danken.
Dank für sehr konstruktive Korrekturhilfen gebührt ferner Herrn Prof. Dr. Th. Bedürftig (Universität Hannover) sowie Herrn Prof. Dr. K. Kießwetter.
Insbesondere der Ernst-Abbe-Stiftung und ihrem Vertreter Herrn Prof. Dr. O. Werner danke ich ganz herzlich für die sehr großzügige Unterstützung dieser Tagung! In dem Beitrag von Herrn Professor Werner wird einiges zur Geschichte und derzeitigen Arbeit der Ernst-Abbe-Stiftung gesagt.
Mein Dank geht schließlich an das Studentenwerk der FSU Jena für die exzellente Gestaltung der "Nachsitzung" am Sonnabend sowie allen weiteren beteiligten Mitarbeitern der FSU.
Jena, im November 1999
|
|
|